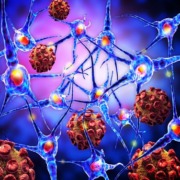Für die meisten Krebspatienten ist nicht die Krankheit an sich, sondern vielmehr die Diagnose das was sie in ein tiefes Loch fallen lässt. Denn sie gibt ein Gefühl des Ausgeliefertseins und außer den begrenzten schulmedizinischen Möglichkeiten, keine Aussichten auf Handeln können.
Naturheilkundlich und in der Alternativmedizin gibt es allerdings eine ganze Reihe von Therapien die unterstützend eingesetzt werden können. Die Kunst besteht darin, die individuell Richtige zu finden. Der erste Schritt kann da nur sein, sich umfassend und ausführlich zu informieren.
Bösartige (maligne) Tumoren entwickeln sich schnell und sind nicht scharf abgegrenzt, sie wachsen zerstörend ins Nachbargewebe, können auch Blut- und Lymphgefäße eröffnen und sie können Tochtergeschwülste (Metastasen) setzen.
Bei der biologisch-ganzheitlichen Betrachtungsweise, handelt es sich immer um ein multifaktorielles Geschehen. Es liegen eine Vielzahl von Funktionsstörungen vor wie:
- Störungen im Hormonhaushalt
- Mängel des körpereigenen Abwehrsystems
- Störungen im Elektrolyt- und Mineralstoffhaushalt
- Störungen im Vitaminhaushalt
- Störung in der Wärmeregulation
- Störung in den Entgiftungs- und Ausscheidungsfunktionen
- Störung im Säure-Basen-Gleichgewicht
- Störungen der Darmtätigkeit
- Störungen in den Zellatmungsfunktionen
Genau hier können die ersten Schritte ansetzen, etwa durch eine Colon-Hydrotherapie, eine Art Darmspülung, um den Darm zu säubern und zu aktivieren.
Hochdosiertes Vitamin C wird ebenfalls erfolgreich eingesetzt. Jedoch muss immer ein ganz individueller Behandlungsplan bei einem erfahrenen Naturheilkundler oder Heilpraktiker erarbeitet werden.
Erste kleine Erfolgsschritte bringen schon immer eine Entgiftung und Entschlackung des Körpers sowie eine Ernährungsumstellung. Dann kann eine gezielte Alternativtherapie ansetzen.
Die anthroposophische Medizin hat gute Heilerfolge mit der Misteltherapie, die auch inzwischen in der sog. Schulmedizin etabliert ist.
Die klassische Homöopathie behandelt den Menschen auf physischer und psychischer Ebene.
Ob Spagyrik, traditionelle chinesische Medizin, mikrobiologische Therapie oder Heilenergie, jedes Heilsystem, welches den Menschen als ganzheitliches Wesen begreift und ihn nicht auf Symptome reduziert, geht davon aus, dass jedes Krankheitsgeschehen auch wieder ein rückläufiges werden kann.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Vor allem wenn Sie für den Erhalt der Homöopathie sind, sollten Sie sich unbedingt dazu eintragen, denn die „Politik“ und etablierte Medizinerschaft ist bestrebt die Homöopathie zu verbieten und / oder abzuschaffen!
Tipps, wie Sie sich vor Krebs schützen:
- Vitamin D gilt als hervorragender natürlicher Krebsschutz.
- Ein gesundes Körpergewicht wirkt sich insgesamt ebenfalls positiv auf die Gesundheit aus.
- Gesunde Omega-3-Fettsäuren schützen vor Krebs und vor anderen Krankheiten.
- Gleiches gilt für grünes Gemüse und für Kurkumin.
Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein Jodmangel die Entstehung von Krebs fördert. Achten Sie daher auf eine ausreichende Zufuhr des Spurenelements. - Vermeiden sollten Sie hingegen Alkohol, elektromagnetische Felder und eine Hormonersatztherapie (beispielsweise bei Wechseljahrsbeschwerden).
- Auch Bisphenol A, Phthalate und andere Xenoestrogene, die zum Beispiel in Kunststoffen, Farben und Lacken vorkommen, gelten als gefährliche Krebsauslöser.
- Von Ihrem Speiseplan sollten Sie alle Arten von Zucker möglichst streichen, vor allem Fruktose.
- Beim Grillen mit Holzkohle entstehen im Fleisch Substanzen, die als hochgradig krebserregend gelten.
- Gleiches gilt für Acrylamide, die sich beim Backen, Rösten und Frittieren stärkehaltiger Lebensmittel entwickeln.
- Einige Studien gehen davon aus, dass unfermentierte Sojaprodukte, aufgrund der enthaltenen östrogenähnlichen Stoffe, die Wucherung von Brustzellen anregen und so Brustkrebs auslösen können.
Weitere Beiträge was Sie tun können:
- Krebs: Gute Chancen wenn alle Alternativen angewendet werden
Mit den Verfahren der Naturheilkunde allein kann Krebs in aller Regel nicht geheilt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie unnötig oder überflüssig wären. Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.
- Ginseng gegen Krebs – Die Studien sehen gut aus
- Heilpflanzen gegen Krebs – Eine gute Option!
- Bittergurke / Cerasee gegen Krebs?
- Cannabis bei Krebs?
- Cimetidin – Wundermittel gegen Darmkrebs?
- Begleitende Krebstherapie: Naturheilkunde und Alternativmedizin als Begleitung
Naturheilverfahren sollten eine konventionelle Krebstherapie in der Onkologie immer begleiten.
- Funktionsdiagnostik zeigt, wie es laufen kann
Bevor der Therapeut die begleitenden Behandlungsmaßnahmen einleitet, wird er vermutlich eine Funktionsdiagnostik vornehmen.
- Enzymtherapie bei Krebs
Mit der Enzymtherapie können Nebenwirkungen bei Krebs gut gelindert werden. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.
- Orthomolekulare Medizin bei Krebs
Orthomolekulare Medizin bei Krebs: Vitalstoffe wie Vitamine, Spurenlemente und Enzyme gegen Krebs? Für mich unentbehrlich in der Therapie!
- Ozontherapie bei Krebs – Eine wichtige Therapieoption
- Darmsanierung bei Krebs – Für mich ein MUSS
Wenn der Darm nicht in Ordnung ist, hilft die beste Ernährung nichts. Folglich ist eine Darmsanierung notwendig.
- Sport gegen Krebs? Ein wichtiges Heilmittel!
Eines der wichtigsten „Medikamente” ist ist Sport gegen den Krebs. Für weitere Informationen, klicken Sie hier.
- Stressabbau und Entspannung bei Krebs
Die meisten Krebspatienten haben durch ihre Erkrankung ein schweres psychisches Trauma erlebt, das verarbeitet und überwunden werden muss. Durch intensive Entspannung wir eine Umstimmung herbeigeführt.
- Hyperthermie bei Krebs
Die Hyperthermie nutzt es aus, dass Krebszellen deutlich empfindlicher auf hohe Temperaturen reagieren, als gesunde Körperzellen. Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.
- Selbstheilung bei Krebs
Mut zum Leben stärkt die Selbstheilung bei Krebs. Weitere Informatione erhalten Sie durch klicken.
Übrigens: Wenn Sie so etwas interessiert, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Newsletter
„Hoffnung bei Krebs“ dazu an:
Beitragsbild: 123rf.com – Alexander Raths