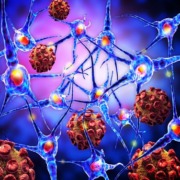Die Orthomolekulare (griech. = richtige Bausteine) Medizin ist ein Teilgebiet der Alternativen Medizin. Die Fachrichtung befasst sich mit dem Einsatz von Vitalstoffen für die Heilung und Vorbeugung gegen Krankheiten. Zu den zahlreichen Verbindungen zählen vor allem Mikronährstoffe, die wir nur in sehr kleinen Mengen aufnehmen müssen, um das Leben aufrechtzuerhalten. Das sind die organischen Vitamine und die mineralischen, elementaren Spurenelemente. Doch auch Makronährstoffe sind unter den fast ausnahmslos essenziellen Stoffen, die unser Körper nicht selbst produzieren kann. Deswegen müssen auch Mineralien, Aminosäuren, einige „Quasi-Vitamine“ und mehrfach ungesättigte Fettsäuren mit der Nahrung aufgenommen werden.
Einige sekundäre Pflanzenstoffe braucht weder die Pflanze, die sie produziert, zum Überleben, noch der Mensch. Doch für beide Organismen bedeuten die organischen Verbindungen einen Vorteil. Der Mensch profitiert von diesen Inhaltsstoffen in Heil- und Nahrungspflanzen, weil sie positive Wirkungen auf die Gesundheit haben. Das ist der Grund, warum auch einige dieser Verbindungen effektive Vitalstoffe darstellen.
Übrigens: Wenn Sie so etwas interessiert, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Newsletter
„Hoffnung bei Krebs“ dazu an:
Wann sind Vitalstoff-Präparate sinnvoll und wann nicht?
War die Orthomolekulare Medizin früher eine absolute Domäne der Naturheilkunde, hat die Schulmedizin längst viele Erkenntnisse daraus übernommen. Es gab Zeiten, als der Nobelpreisträger und Vater der Orthomolekularen Heilkunde Linus Pauling von Schulmedizinern praktisch verachtet wurde. Besonders seine Forderung nach hochdosiertem Vitamin C für alle Menschen war Zielscheibe von Spott-Attacken. Heute ist vielfach nachgewiesen, dass viele Krebserkrankungen gehäuft bei Menschen auftreten, die den einen oder anderen Vitalstoffmangel haben (Prognostic effects of 25-hydroxyvitamin D levels in early breast cancer).
Dabei ist nicht jeder Vitalstoffmangel sofort am Blutbild sichtbar. Auch wenn die Plasma-Werte noch im Normbereich liegen, kann eine verringerte Verfügbarkeit von Vitaminen vorliegen. Oft ist eine Fehlernährung die Ursache, doch auch eine unzureichende Resorption der essenziellen Verbindungen kann zugrundeliegen. Manche Stoffwechselstörungen führen dazu, dass Vitamine nicht verarbeitet werden können. Neben den für jeden Vitalstoff spezifischen Mangel-Symptomen entstehen dann chronische Krankheiten des Herzens, Arteriosklerose und Magen-Darm-Störungen. Auch die Entstehung von Krebs ist wahrscheinlicher, wenn zu wenig Vitalstoffe aufgenommen werden.
Wer an Krebs erkrankt ist, hat ähnlich wie Menschen mit anderen starken Belastungen einen erhöhten, oft doppelt so hohen Bedarf an Vitaminen. Diese Bedingungen begünstigen ein Defizit an Vitalstoffen ebenfalls, sodass die Einnahme von Präparaten (Supplemente) sinnvoll sein kann.
Eine gesunde und reichhaltige Ernährung reicht dann nicht mehr aus, um den Bedarf zu decken. Täglich 750 Gramm Obst und Gemüse und 300 Gramm Vollkornbrot sind bei durchschnittlichen Lebensverhältnissen genug, um den Körper mit allem zu versorgen, was er braucht. Zusätzlich zu den vegetarischen Vitalstoff-Lieferanten gehören Fisch (Kabeljau, Makrele, Hering, Lachs, Forelle) und ausgewählte Pflanzenöle (von Leinsamen und Oliven) zur gesunden Kost. Industriell verarbeitete Nahrungsmittel, zuviel Fleisch (besonders vom Schwein), Zucker und weißes Mehl in jeder Form sollten möglichst gemieden werden. Lebensmittel in Bio-Qualität sind grundsätzlich besser.
Welche Vitalstoffe bei Krebs helfen, muss genau abgestimmt sein
Vitalstoffe können sowohl die Nebenwirkungen der Krebs-Therapie lindern als auch direkt zur Heilung beitragen. Das beruht nicht auf rein theoretischen Ableitungen, sondern auf Ergebnissen klinischer Studien. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass es gut überlegt sein muss, welcher Vitalstoff ergänzt werden kann. Besonders die Blutwerte von Selen und Vitamin D sollte der Arzt bestimmen lassen, um die Notwenigkeit einer Supplementation zu ermitteln. So kann der Mediziner auch die Dosierung genau festsetzen, damit die Zielwerte der Vitalstoffe erreicht werden.
Von entscheidender Bedeutung ist es auch, wann die Supplementation erfolgt. Einige Vitalstoffe können sogar Schaden anrichten, wenn sie kurz vor oder während einer Chemo- oder Strahlen-Therapie eingenommen werden. Denn viele dieser Wirkstoffe sind Antioxidantien, die vor aggressiven Stoffwechselabfällen schützen. Doch viele Chemotherapeutika verstärken gerade den oxidativen Abbau von Zell-Strukturen, um damit die Krebszellen zu treffen, die in besonders hohem Maße stoffwechsel-aktiv sind.
Eine Studie besagt, dass die antioxidativen Vitalstoffe während der Chemotherapie die Erfolgsaussichten verschlechtern. Auch im Vorfeld der Maßnahme können Präparate mit Vitamin A, Carotinoiden, den Vitaminen C und E sowie Coenzym Q10 das Wiederaufflammen der Erkrankung wahrscheinlicher machen. Die Lebenserwartung der Krebspatienten ist geringer, wenn diese Vitalstoffe begleitend zur Chemotherapie gegeben werden. Ähnliche Ergebnisse ergaben sich für zwei Vitalstoffe, die nicht zu den Antioxidantien zählen. So war unter Supplementationen von Vitamin B12, Omega-3-Fettsäuren und Eisen vor und während der Chemotherapie die Rückfall-Quote höher und die Lebenserwartung geringer. Multivitamin-Präparate beeinflussten den Therapie-Verlauf überhaupt nicht. (Dietary Supplement Use During Chemotherapy and Survival Outcomes of Patients With Breast Cancer Enrolled in a Cooperative Group Clinical Trial [SWOG S0221]).
Die oft als Anhaltspunkt herangezogenen Tierversuche müssen an dieser Stelle kritisch betrachtet werden. So kommt eine Studie bei Mäusen mit Eierstockkrebs zu dem Ergebnis, dass Ascorbinsäure (Vitamin C) entartete Zellen abtöten kann, weil die Konzentration des Oxidations-Mittels Wasserstoffperoxid (H2O2) ansteigt (High-dose parenteral ascorbate enhanced chemosensitivity of ovarian cancer and reduced toxicity of chemotherapy).
Was sagen klinische Studien?
Trotz dieser Komplikationen in der Betrachtung werden Vitalstoffe zur Unterstützung der Krebsbehandlung stetig wichtiger. Noch deckt die Studien-Lage nicht alle positiven Wirkungen und zu beachtenden Aspekte ab. Es ist nicht leicht für den Arzt zu entscheiden, wie die Supplementation genau konzipiert sein muss. Wahrscheinlich hängt die Wirkung der einzelnen Vitalstoffe immer auch von der Art der Tumore ab. Eine klinische Studie fand erfolgversprechende Fakten in Einzelfällen von Eierstockkrebs. Die Arbeit untersuchte das Schicksal von drei Patientinnen, die über drei Jahre lang 60 Gramm Vitamin C als Infusion erhielten. Bei allen konnte der Krebs vollständig besiegt werden (Intravenously administered vitamin C as cancer therapy: three cases). Bei Patientinnen, die an Brustkrebs litten, konnten die Nebenwirkungen und die Beschwerden durch die Erkrankung mit Vitamin C herabgesetzt werden. Sie erhielten täglich 7,5 Gramm des Vitalstoffs per Infusion für die Dauer von vier Wochen (Intravenous vitamin C administration improves quality of life in breast cancer patients during chemo-/radiotherapy and aftercare: results of a retrospective, multicentre, epidemiological cohort study in Germany).
Auch Menschen mit Krebs der Bauchspeicheldrüse profitierten in einer Untersuchung von Vitamin C. Die Patienten bekamen während der Chemotherapie zweimal wöchentlich Infusionen mit 15 bis 125 Gramm des Wirkstoffs. Der Tumor schrumpfte um rund 10 % und die Lebenserwartung verdoppelte sich im Vergleich zu anderen Fällen (Pharmacological ascorbate with gemcitabine for the control of metastatic and node-positive pancreatic cancer (PACMAN): results from a phase I clinical trial). Zwei Punkte müssen bei hochdosiertem Vitamin C allerdings beachtet werden. Es darf kein Mangel am Enzym G6PD (Glucose‑6-Phosphat-Dehydrogenase) vorliegen, weil sonst die roten Blutkörperchen zerstört werden. Die Infusionen dürfen auch nie während einer Strahlenbehandlung erfolgen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Viele Vitamine sind Antioxidantien
Zu weiteren Antioxidantien, die während der Krebsbehandlung und zur Nachsorge erwogen werden können zählt Vitamin A. Der Bedarf ist im Krankheitsfall doppelt so hoch wie beim Gesunden, weswegen sich eine Supplementation lohnen könnte. Als Retinol kommt der Vitalstoff vor allem in tierischen Lebensmitteln vor und als Provitamin A in Obst und Gemüse. Vitamin A kann der Körper nicht in Reserve halten und muss kontinuierlich aufgenommen werden.
Patienten mit dem Non-Hodgkin-Lymphom, Dickdarm- und Brustkrebs haben bei optimalem Vitamin-D-Spiegel eine höhere Lebenserwartung (Vitamin D: Update 2013: From rickets prophylaxis to general preventive healthcare, Vitamin D insufficiency and prognosis in non-Hodgkin’s lymphoma). Eine Supplementation bei Krebserkrankungen sollte etwa doppelt so hoch sein, wie sie dem normalen Bedarf entspricht. Es gibt Hinweise darauf, dass Vitamin D Krebszellen direkt abtöten kann, wenn der Arzt die Dosierung dem Plasma-Spiegel anpasst. Erfolgversprechend sein soll dieses Vorgehen auch bei Knochen-, Brust- und Prostatakrebs. Tierische Lebensmittel sind die besten Quellen für die Aufnahme über die Nahrung.
Während der Krebs-Therapie braucht der Körper auch größere Mengen vom antioxidativen Vitamin E. Die benötigte Tagesdosis beim Gesunden beträgt 20 Milligramm, Krebspatienten das 20-fache. Nahrungsquellen des Vitalstoffs sind Pflanzenöle, Nüsse, Weizen und andere Getreide sowie Eier.
Vitamine der B-Gruppe und Aminosäuren helfen ebenfalls
Auch die Vitamine B1, B2, B3, B6, B12 und Biotin spielen in der Unterstützung der Krebsbehandlung eine Rolle. Sollten Nervenstörungen durch die Chemotherapie auftreten oder die Blutbildung gestört sein, sind Supplementationen in Erwägung zu ziehen. Lebensmittel mit hohem Gehalt an den Vitalstoffen sind Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte sowie Fisch und Fleisch. Vitamin B9 (Folsäure) sollte nie parallel zur Chemotherapie gegeben werden, sondern nur zur Rekonvaleszenz. Coenzym Q10 kommt für Krebspatienten als Supplementation weniger in Betracht.
Glutamin hat den Ruf, das Wachstum von Krebszellen zu verlangsamen. Die Aminosäure ist ebenso wie Cystein Bestandteil des Antioxidans Glutathion. Ob diese Nährstoffe in der Krebs-Therapie nützlich sind, kann zurzeit schwer beurteilt werden. L-Carnitin ist für den mitochondrialen Energie-Stoffwechsel erforderlich. Die überwiegende Zahl der Krebspatienten hat erniedrigte Plasma-Werte der Aminosäure. Die Supplementation kann Nebenwirkungen der Chemotherapie in Grenzen halten (Acetyl-L-carnitine for the treatment of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a short review) und die Lebenserwartung und Lebensqualität der Patienten verbessern (L-Carnitine-supplementation in advanced pancreatic cancer (CARPAN) – a randomized multicentre trial). L-Carnitin kann zusammen mit Omega-3-Fettsäuren einen noch größeren Nutzen bringen.
Mineralien und Spurenelemente
Krebspatienten profitieren von einer Supplementation mit Magnesium, dessen täglicher Bedarf rund ums Doppelte erhöht ist. Das Mineral ist für die optimale Funktion von Muskeln, Herz und Nerven unerlässlich. Lebensmittel mit hohem Gehalt an Magnesium sind Fleisch, Vollkorngetreide, Nüsse, Obst und Gemüse.
Der Calcium-Bedarf ist vor allem bei Darm- und Knochenkrebs erhöht. Lieferanten sind Milch, Kräuter, Obst und Gemüse sowie etliche Körnerfrüchte wie Sesam.
Das Spurenelement Zink ist im katalytischen Zentrum antioxidativer Enzyme wirksam. Es ist für geschwächte Menschen, die unter Krebs und der Chemo- und Strahlentherapie leiden, ein Supplement für ein leistungsfähiges Immunsystem. Die Patienten brauchen deswegen doppelt so hohe Mengen Zink im Vergleich zu Gesunden. Das Spurenelement ist enthalten in Vollkorn-Produkten, Hülsenfrüchten, Fisch und Fleisch sowie Eiern.
Selen ist ein Spurenelement, das im Stoffwechsel der antioxidativen Mechanismen eingebunden ist. Supplementationen können bei Krebspatienten Blut-Transfusionen überflüssig machen, weil Blut- und Nierenstörungen durch die Chemotherapie in Grenzen gehalten werden (The protective role of selenium on the toxicity of cisplatin-contained chemotherapy regimen in cancer patients). Auch andere Nebenwirkungen wie Bauchschmerzen und andere Magen-Darm-Beschwerden, Schleimhautentzündungen und Haarausfall sowie das Fatigue-Syndrom treten mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf. Das ist durch eine Studie an Frauen mit Eierstockkrebs nachgewiesen (Sieja K, Talerczyk M Selenium as an element in the treatment of ovarian cancer in women receiving chemotherapy).
Menschen mit dem Non-Hodgkin-Lymphom haben durch eine Selen-Supplementation eine erhöhte Lebenserwartung, weil Krebsellen einem früherem Zelltod anheim fielen (High-dose sodium selenite can induce apoptosis of lymphoma cells in adult patients with non-Hodgkin’s lymphoma). Natriumselenit konnte in klinischen Studien Schluckbeschwerden bei Patienten mit Krebs an Kopf und Hals lindern (Limited effects of selenium substitution in the prevention of radiation-associated toxicities. results of a randomized study in head and neck cancer patients.).
Dasselbe Supplement verlängerte die Lebenserwartung nach einer Strahlentherapie bei Patientinnen, die an Gebärmutterhals- oder Gebärmutterkrebs litten. Auch der strahleninduzierte Durchfall konnte durch die Medikation gelindert werden (Multicenter, phase 3 trial comparing selenium supplementation with observation in gynecologic radiation oncology).
Sekundäre Pflanzenstoffe
Die bioorganischen Verbindungen sind in umfangreicher und vielfältiger Form in Lebensmitteln enthalten. Viele werden aus den Pflanzen extrahiert und können als Nahrungsergänzungsmittel erworben werden. Viele dieser Wirkstoffe gehören zu den Antioxidantien, einige können das Wachstum von Krebszellen hemmen. Andere tragen zur Entgiftung bei oder stärken das Immunsystem. Die Verbindungen zählen zu unterschiedlichen Substanzklassen wie den Flavonoiden, Saponinen oder Phytohormonen. Gerade während einer Chemotherapie ist es oft kaum möglich, genügend Obst und Gemüse zu essen, um sich gut mit sekundären Pflanzenstoffen zu versorgen. Dann lohnt es sich, auf Präparate zurückzugreifen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilpflanzen-Newsletter dazu an. Darin geht es im Wesentlichen um Heilpflanzen, aber auch um Bachblüten oder Homöopathische Mittel:
Dieser Beitrag wurde letztmalig am 26.06.2023 aktualisiert und ergänzt.