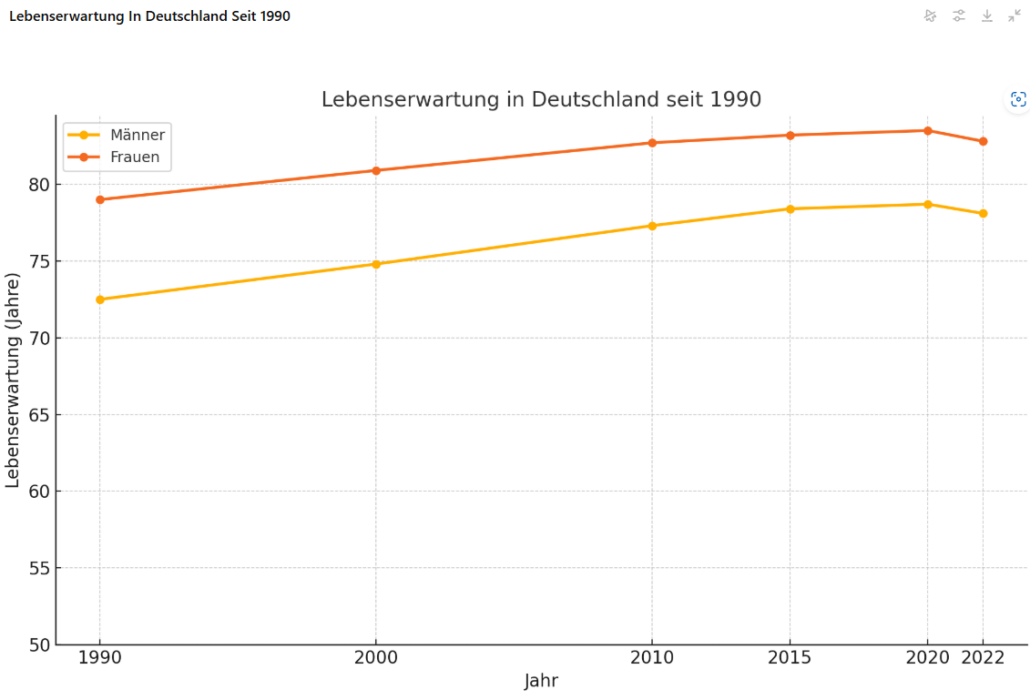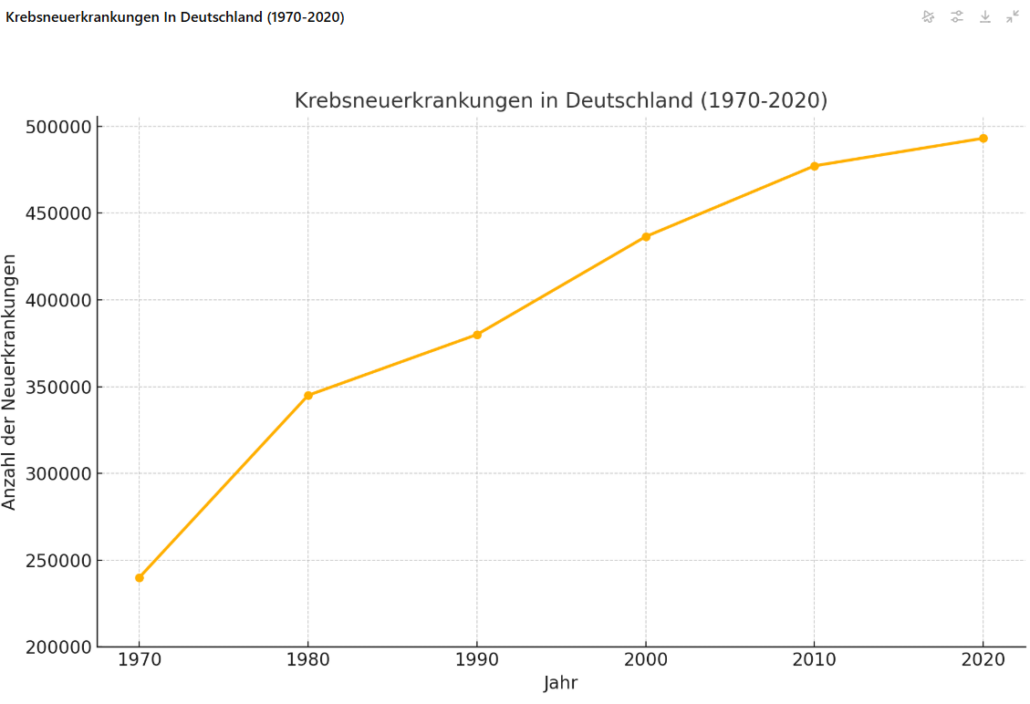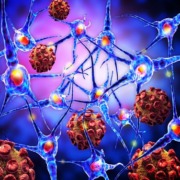Ähnlich wie Ivermectin ist Fenbendazol eine Substanz, mit deren Hilfe Parasiten bekämpft werden können. Im Fall von Fenbendazol handelt es sich um ein Breitband-Anthelminthikum (Entwurmungsmittel), das in der Tiermedizin als Mittel gegen Endoparasiten zum Einsatz kommt.
Das Wirkspektrum von Fenbendazol umfasst Fadenwürmer und Bandwürmer. Da die Substanz relativ langsam ihre Wirksamkeit entfaltet, muss sie über einen längeren Zeitraum gegeben werden. Bei einer schnelleren Darmpassage, wie sie z.B. bei Fleischfressern vorliegt, ist die Wirksamkeit unter Umständen weniger gut ausgeprägt. Die praktischen Erfahrungen mit der Substanz in Bezug auf Nebenwirkungen sind sehr gut, da selbst Überdosierungen sehr selten zu Nebenwirkungen führen und dann auch nur geringfügig.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Fenbendazol und Krebs
Ähnlich wie Ivermectin scheint Fenbendazol krebshemmende Eigenschaften zu haben, die so ausgeprägt sind, dass sie therapeutisch verwertbar zu sein scheinen.
Ein Review vom September 2024 fasst die Eigenschaften von Fenbendazol in Bezug auf seine krebshemmende Wirkung so zusammen: [1]
„Da Fenbendazol derzeit weder von der FDA noch von der EMA zugelassen ist, sind seine Pharmakokinetik und Sicherheit beim Menschen in der medizinischen Literatur noch nicht gut dokumentiert. Dennoch können Erkenntnisse aus bestehenden In-vitro- und In-vivo-Tierstudien zu seiner Pharmakokinetik gewonnen werden.
Angesichts der geringen Kosten von Fenbendazol, seines hohen Sicherheitsprofils, seiner Zugänglichkeit und seiner einzigartigen antiproliferativen Wirkung wäre Fenbendazol die bevorzugte Benzimidazolverbindung zur Behandlung von Krebs. Um die Patientensicherheit bei der Wiederverwendung von Fenbendazol zu gewährleisten, ist es wichtig, klinische Studien durchzuführen, um seine potenziellen Antikrebswirkungen, optimalen Dosierungen, Therapieschemata und Verträglichkeitsprofile zu bewerten.
Dieser Bericht konzentriert sich auf die Pharmakokinetik von oral verabreichtem Fenbendazol und seine vielversprechenden biologischen Antikrebsaktivitäten, wie die Hemmung der Glykolyse, die Herunterregulierung der Glukoseaufnahme, die Induktion von oxidativem Stress und die Verstärkung der Apoptose in veröffentlichten experimentellen Studien. Darüber hinaus haben wir das Toxizitätsprofil von Fenbendazol bewertet und Möglichkeiten zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit des Arzneimittels, zur Steigerung seiner Wirksamkeit und zur Verringerung der potenziellen Toxizität diskutiert.“
Eine koreanische Arbeit aus dem Jahr 2023 untersuchte den krebshemmenden Effekt von Fenbendazol bei Eierstockkrebs. [2]
Die Forscher beschreiben Fenbendazol als wenig wasserlöslich, was den Einsatz bei einer Krebstherapie erschweren würde. Daher untersuchten die Forscher den Einsatz von Nanopartikeln, mit deren Hilfe die Substanz zum Zielort transportiert werden sollte.
Ergebnisse: Fenbendazol verringerte die Zellproliferation sowohl chemosensitiver als auch chemoresistenter Eierstockkrebszellen signifikant. In Zelllinien-Xenograft-Mausmodellen hatte eine orale Behandlung mit Fenbendazol jedoch keinen Effekt auf die Tumorreduktion. Bei intraperitonealer Verabreichung wurde Fenbendazol nicht absorbiert, sondern sammelte sich im intraperitonealen Raum an. Durch den Einsatz von Nanopartikeln wurde eine ausreichende Wasserlöslichkeit erreicht und die Arzneimittelabsorption wurde verbessert. Die Nanopartikel mit Fenbendazol verringerten die Zellproliferation in Eierstockkrebszelllinien signifikant. Die intravenöse Injektion der Nanopartikel reduzierte das Tumorgewicht im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant.
Eine koreanische Studie von 2022 untersuchte den krebshemmenden Effekt von Fenbendazol auf therapieresistente Darmkrebszellen. [3]
Auch hier zeigte sich eine bedeutsame Wirksamkeit von Fenbendazol, indem die Substanz bei den therapieresistenten Krebszellen eine Apoptose auslöste. Außerdem sahen die Autoren ebenfalls einen Zellzyklusstopp, was heißt, dass die Tumorzellen sich nicht mehr teilen und damit vermehren konnten.
Schlussfolgerung der Autoren:
„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Fenbendazol eine potenzielle alternative Behandlungsmethode für 5-Fluorouracil-resistente Krebszellen sein könnte und dass für die Antikrebswirkung von Fenbendazol in 5-Fluorouracil-resistenten SNU-C5-Zellen kein p53 erforderlich ist.“
Hier eine koreanische Studie von 2023, die Fenbendazol in vitro und in vivo bei Mäusen mit Lymphdrüsenkrebs untersuchte. [4]
Hier zeigte sich, dass Fenbendazol bei EL-4-Zellen Zellzyklusstopps verursachte. EL-4-Zellen sind eine murine T-Lymphoblasten-Zelllinie, die aus einem Lymphom stammt, das in einer C57BL-Maus induziert wurde. Sie werden in der immunologischen Forschung häufig als Modellsystem zur Untersuchung von T-Zell-Lymphomen und des Immunsystems verwendet.
In vivo jedoch zeigte die Substanz keine ausgeprägten Effekte. In diesem Fall scheinen Labor- und Tiermodell sich zu widersprechen, weshalb die Autoren die Notwendigkeit weiterer Studien sehen, um hier Erklärungen zu bekommen.
Aussicht
Es gibt noch eine Reihe weiterer Arbeiten, die sich aber fast ausschließlich mit Laborkonzepten beschäftigen, indem Forscher Zelllinien von Krebszellen verschiedenster Art Fenbendazol aussetzen und dann beobachten, was mit den Zellen passiert. Die zuletzt diskutierte Arbeit zeigt, dass der Einsatz im lebenden Organismus andere Resultate vorzeigen kann, die denen im Labor widersprechen. In Korea schien es 2020 sogar einen „Fenbendazol-Skandal“ gegeben zu haben, wo Medien Krebspatienten gegenüber überzogene Heilversprechen gemacht hatten. [5]
Von daher lässt sich zusammenfassen, dass Fenbendazol zwar das Potential zu haben scheint, eine wirksame krebshemmende Substanz zu sein. Zumindest lassen das die Laborresultate vermuten. Aber Tiermodelle spiegeln diese positive Tendenz noch nicht wider, teilweise auch, weil es nur sehr wenige Tierversuche gibt. Und klinische Studien am Menschen scheinen vollkommen zu fehlen.
Übrigens: Wenn Sie so etwas interessiert, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Newsletter
„Hoffnung bei Krebs“ dazu an:
Quellen:
Beitragsbild: fotolia.com – crevis
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 erstellt.